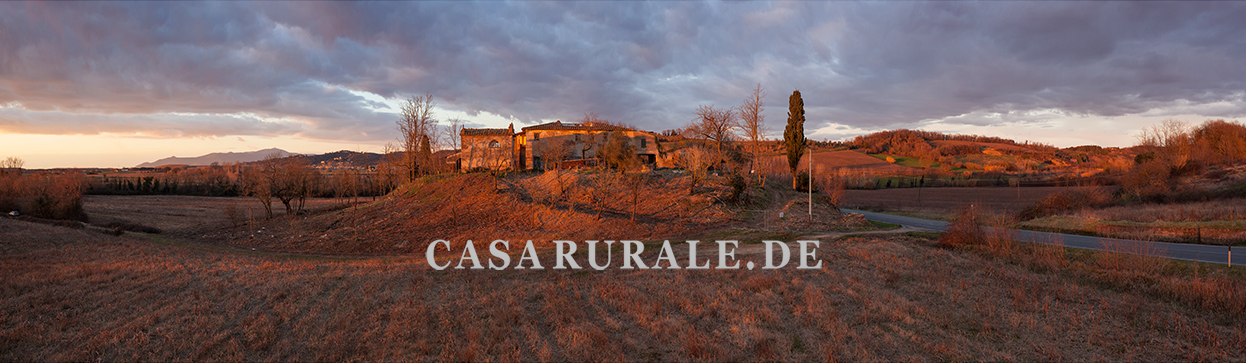Nutzen und ästhetisches Ideal standen bei der ländlichen Baukunst in einem engen Verhältnis. Das gilt nicht nur für die Villa als organisiertes landwirtschaftliches Zentrum.
Bauherren und Baumeister sahen in der Errichtung von landwirtschaftlichen Gebäuden nicht allein den ökonomischen Nutzen. Die Gestaltung eines Landgutes war eine der trefflichsten Möglichkeiten, Geist, kulturelle Ideale und Vermögen zu präsentieren. Das Maß und die Ordnung in der Architektur galt dabei als Spiegelbild der Kulturideale und war ein wesentliches für die Schönheit verantwortliches Kriterium.
Der Humanist und Architekt Leon Battista Alberti nannte das harmonische Zusammenspiel und die Ausgewogenheit der verschiedenen Elemente concinnitas und definierte diese als Paradigma für Kunst und Gesellschaft.
Dass vom Villenbau ein starker ästhetischer Einfluss auf "geringere" Landhäuser wirkte, kann man sehr gut in der Gegend um Florenz beobachten. Die Bauernhäuser sind nahezu Wiederholungen der Herrenhäuser in bescheidenerem Umfang.
Im 16. Jahrhundert wurde Italien Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten Spanien und Frankreich. Erst mit dem Friedenschluss von Cateau-Cambrésis zwischen Philipp II. und Heinrich II. am 3. April 1559 wurde Spaniens Herrschaft über Italien, die bis 1714 andauerte, besiegelt. Wirtschaftliche Depressionen die aus der hohen Steuerlast der spanischen Krone aber auch aus der Verlagerung der Welthandelsrouten vom Mittelmeer in den Atlantik resultierten, bewegten die vermögenden Schichten ihr Kapital verstärkt in Landbesitz und in den Ausbau von Villen und Landgütern (fattorie oder poderi) zu investieren. Damit beginnt die große Periode der italienischen Landhausarchitektur und der Ausbau Italiens zur Kulturlandschaft.
Die Ende des Mittelalters entstandene Halbpacht wirkte für den Ausbau bzw. die Erschließung neuer Landgüter wie ein Katalysator, denn sie entband die Besitzer der Länderein von der Bezahlung der Arbeitskräfte.
Allerdings gab es auch negative Auswirkungen. Die anfänglich für beide Seiten vorteilhafte Vertragsform nahm von Seiten der Gutsbesitzer immer restriktivere Züge an, wobei sie versuchten, die Freiheit der Bauern und ihrer Familien stark einzuschränken. Je größer der Grundbesitz und je mächtiger die Herren, desto stärker war der Druck auf ihre Bauern. Diese waren durch Missernten oftmals zur Kreditaufnahme gegenüber ihren Verpächtern gezwungen. Die Verschuldung der Bauern nutzen die Gutsbesitzer zu ihrem Vorteil und forderten ihnen dafür zusätzliche Leistungen ab. Diese Härte setzte sich dann über Generationen fort, denn ein verschuldeter Bauer konnte das Landgut nicht einfach verlassen. Floh er, drohte ihm Kerkerhaft.
Natürlich gab es auch gut gestellte Bauern. Vor allem in der Nähe der Städte, in den fruchtbaren Gegenden und im Fall, dass ein Bauer auch kaufmännische Fähigkeiten besaß, war der bäuerlichen Familie eine Gewinnerzielung über die Existenzsicherung hinaus möglich. Der Einsatz des angesparten Kapitals führte zuweilen dazu, dass sich Bauern eigenes Land erwerben konnten.
Die Entwicklung der Landwirtschaft war in den italienischen Regionen sehr unterschiedlich. Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Wein und Öl investierten die Landbesitzer im Großherzogtum Toskana in immer größerem Umfang in den Wein- und Olivenanbau sowie in die Seidenproduktion.